Das Veröffentlichen von Forschungsergebnissen ist ein wichtiger Meilenstein im Forschungszyklus. Wissenschaftspolitisch besteht weitgehend Konsens, dass Open Access (OA) langfristig als wissenschaftlicher Publikationsstandard zu etablieren ist.1 Neben der Präferenz, Erstveröffentlichungen nach dem Gold-OA-Modell zu publizieren, wird zunehmend die Stärkung des Diamond-OA-Publikationsmodells gefordert.2
Dieser wissenschaftspolitischen Ausrichtung folgen auch die Mitgliedshochschulen der Digitalen Hochschule NRW (DH.NRW),3 darunter die RWTH Aachen University (RWTH). 2023 hat die AG Openness der DH.NRW die „Open-Access-Strategie der Hochschulen des Landes NRW“4 veröffentlicht. Darin wird die „Überführung der Forschungsergebnisse des Landes in den Open Access“ als klares Ziel ausgegeben. Basierend auf acht strategischen Leitlinien,5 werden zur Erreichung dieses Ziels zehn Handlungsfelder identifiziert und Handlungsempfehlungen für die relevanten Akteure aus Politik, Hochschule und deren Infrastruktureinrichtungen formuliert, die auf die Schaffung geeigneter finanzieller, rechtlicher, technischer und administrativer Strukturen zielen.6
Im Handlungsfeld 1 (HF 1) „OA-Erstveröffentlichung“ wird neben dem Gold-OA-Modell auch ausdrücklich das Diamond-OA-Modell als Optimum des OA-Publizierens definiert. Es wird ferner die Notwendigkeit infrastruktureller Unterstützung für die Forschenden betont, die jenseits kommerzieller Verlage publizieren, und „die Etablierung nachhaltiger und innovativer OA-Publikationsinfrastrukturen, die von den Hochschulbibliotheken in enger Kooperation mit der Landesinitiative openaccess.nrw und dem hbz geschaffen werden“.7
In eine ähnliche Richtung – wenngleich weniger stark und allgemein formuliert – zielt die OA-Policy, die die RWTH in 2016 verabschiedet hat.8 Darin bekennt sich die RWTH eindeutig zum Open Access im Sinne der Berliner Erklärung9 und bestärkt ihre Forschenden, die Ergebnisse ihrer Forschungsleistung im Open Access zu publizieren.10 Unter Beachtung fachkultureller Anforderungen sollen Einsatz und Anwendung von Open Access weiter ausgebaut werden, indem den Forschenden entsprechende Infrastrukturen, Verfahren und Ansprechpartner bereitgestellt werden.
In den vergangenen Jahren hat die RWTH wichtige Aktivitäten im Transformationsprozess des wissenschaftlichen Publizierens auf dem Weg zum OA-Standard vorangetrieben. Die Universitätsbibliothek (UB) der RWTH versteht sich dabei als kompetente Dienstleisterin für ihre Forschenden und sieht sich diesem Prozess als infrastrukturelle Einrichtung besonders verpflichtet. In den letzten zehn bis 15 Jahren haben sich Angebote rund um das wissenschaftliche Publizieren zu einem stetig wachsenden Aufgabenbereich der UB entwickelt,11 nicht zuletzt mit einem besonderen Fokus auf das OA-Publizieren.
2023 wurde unter der Schirmherrschaft des Prorektors Forschung der „Runde Tisch Publizieren“ an der RWTH ins Leben gerufen, mit dem Ziel, Herausforderungen des wissenschaftlichen Publizierens zu erörtern und Handlungsstrategien zu entwickeln. Als Sounding Board für das Prorektorat bündelt der Runde Tisch die Expertise von ca. 25 publikationserfahrenen Mitgliedern aus allen Fakultäten und Profilbereichen. Im Frühjahr 2024 startete zusätzlich die breiter angelegte Online-Veranstaltungsreihe „Publishing Forum“, die sich an publizierende Forschende der RWTH richtet. Sie dient als Informations- und Austauschformat über Entwicklungen und Herausforderungen des wissenschaftlichen Publizierens mit Impulsvorträgen nationaler wie internationaler Referent*innen sowie Mitarbeitenden an der RWTH.12 Beide Stakeholder-Formate („Runder Tisch Publizieren“ und „Publishing Forum“) werden von der UB gemeinsam mit dem Forschungsdezernat im Auftrag des Prorektorats Forschung organisiert.
Wichtige Bausteine zur Implementierung von OA sind die Teilnahme der RWTH an DEAL- und wei-teren Transformationsverträgen13 sowie der seit dem 01.01.2024 eingerichtete Open-Access-Publikationsfonds.14 Die Förderung kommt aufgrund der fachlichen Ausrichtung der RWTH vor allem Fächern aus dem technisch-naturwissenschaftlichen und medizinischen Bereich zu Gute. Zwar stehen diese Mittel selbstverständlich auch den Fächern aus den Geistes- und Sozialwissenschaften zur Verfügung, allerdings profitieren diese davon weitaus weniger, da das Publizieren als OA-Buch und in OA-Journals hier deutlich geringer ausgeprägt ist.
Hinsichtlich Erstveröffentlichungen sind diese – zweifellos wichtigen – Aktivitäten allerdings vor allem auf das kostenbasierte Gold-OA-Publizieren ausgerichtet. Ein Ziel ist es daher, die Bibliodiversität im wissenschaftlichen Publikationssystem zu unterstützen, um den wissenschaftlichen Publikationsmarkt nicht allein den großen, kommerziellen Verlagen zu überlassen.
Bereits seit 2015 betreibt die UB zusammen mit dem IT-Center das institutionelle Repositorium RWTH Publications,15 das zugleich Volltextserver, Hochschulbibliographie und Forschungsdatenrepositorium repräsentiert.16 Neben dem Nachweis des Publikationsoutputs17 haben die Forschenden die Möglichkeit, wissenschaftliche und wissenschaftlich relevante Dokumente zweit- oder auch erstzuveröffentlichen.
Zwar ist die kostenfreie Erstveröffentlichung von Reports, White Papers, Qualifikationsschriften und Tagungsbänden über das Repositorium möglich, jedoch stellte die infrastrukturelle Unterstützung von Diamond-OA-Journals bislang ein Desiderat dar.
Freilich lassen sich auch Gesamthefte und Einzelbeiträge auf RWTH Publications veröffentlichen, jedoch erweist sich dies als suboptimal, mangelt es doch an diversen für ein Journal essentiellen Anforderungen, wie z.B. eine eigene Homepage mit eigener Domain,18 die Vergabe von Digital Object Identifier (DOI) unter eigenem Präfix, die Abwicklung des gesamten redaktionellen Prozesses in einem System, Schnittstellen zum Directory of Open Access Journals (DOAJ) und anderen Nachweissystemen.
Mit dem neuen Angebot RWTH Open Access Journals (s.u. Abschnitt 3) möchte die UB aktuelle und künftige Herausgeber*innen von Diamond-OA-Journals im Sinne der OA-Strategie der Hochschulen NRWs und der OA-Policy der RWTH unterstützen und dieses Desiderat beheben. Verbreitet ist das Diamond-OA-Modell vor allem in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern.19 Auch an der RWTH gibt es Diamond-OA-Journals aus diesem Fächerkreis, die die UB unterstützen möchte, wobei das Angebot freilich für alle Fächer an der RWTH gilt. Damit kommt die UB zugleich auch dem Auftrag nach, fachkulturelle Anforderungen im Ausbau von OA mit zu berücksichtigen.
Bereits im Jahr 2003 initiierte das damalige Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie des Landes NRW, heute Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW), eine Maßnahme zur Förderung des Aufbaus von OA eJournals im Land NRW, indem es das Hochschulbibliothekszentrum Nordrhein-Westfalen (hbz) mit der Entwicklung und Betreuung des Publikationssystems Digital Peer Publishing (DiPP) beauftragte.20
Dieser frühe Vorläufer eines Diamond-Open-Access-Modells wird seit 2022 im Rahmen der Digitalen Hochschule NRW (DH.NRW) in die Strukturen der Landesinitiative openaccess.nrw überführt. 21
Die Landesinitiative stellt innerhalb ihrer drei Programmbereiche zentrale Services für Open Access in NRW bereit: Der erste Programmbereich (Universität Duisburg-Essen) baut das landesweite Netzwerk auf und stellt Informationen zusammen, bietet eine rechtliche Beratung an und schafft Anreize22, der zweite Programmbereich stellt eine landesweite OA-Infrastruktur bereit und der dritte (Universität Bielefeld) übernimmt das Monitoring über OA-Publikationsoutput sowie -kosten.
Betrachtet man den OA-Anteil am Publikationsaufkommen der NRW-Hochschulen, so ist festzustellen, dass dieser innerhalb der letzten zehn Jahre stark gestiegen ist. Diamond OA macht jedoch einen konstant geringen Anteil von durchschnittlich 2% aus.23 Land und Hochschulen sind daher bestrebt, diesen Anteil zu erhöhen und Diamond OA in NRW zu verbreiten.
Diesem Anliegen widmet sich von der praktischen Seite her der Programmbereich Infrastruktur, mit dessen Leitung das hbz betraut wurde. Dazu bietet es das Hosting zweier Publikationssysteme an, sowohl zur Veröffentlichung von Open-Access-Monografien (Open Monograph Press - OMP) als auch für Open-Access-Zeitschriften (Open Journal Systems - OJS).24 Der Dienst auf Basis von OJS umfasst Setup und Wartung der benötigten Hard- und Software, Bereitstellung von Test- und Produktivumgebung von Multi-Journal-Instanzen unter (organisations- oder redaktions-) eigener Domain, eine bedarfsorientierte Auswahl von Plug-ins sowie technischen Support. Das zentrale Infrastrukturangebot kann dezentral durch die Bibliotheken genutzt werden. Ergänzend dazu organisiert der Programmbereich regelmäßige Online-Treffen, bei denen sich Hochschulbibliotheken aus NRW wechselseitig über Best Practices zur Nutzung von OJS austauschen, Lösungen nachnutzen sowie eigene Publikationsdienste aufbauen und optimieren können.25 Das arbeitsteilige Modell schont durch den infrastrukturellen Rahmen technische (Personal-)Ressourcen und stärkt zudem die Rolle der Bibliotheken als Schnittstelle und Multiplikatorinnen in der OA-Publikationslandschaft. Die Forschenden profitieren von der bibliothekarischen Expertise und der Betreuung durch die Bibliotheken.
Das Angebot der Landesinitiative war für die UB Anlass, für die RWTH – wie oben angesprochen – eine Publikationsplattform für eJournals anzubieten, womit die UB ihr Open-Access-Portfolio um einen weiteren Dienst ergänzt. Er richtet sich an Wissenschaftler*innen an der RWTH, die ein OA-Journal entweder neu gründen, auf Open Access umstellen oder auf eine neue technische Basis migrieren möchten.
Zu Beginn stellte sich die Frage, welcher konkrete Bedarf mit einem solchen Dienst mit welchen Ressourcen zur Erreichung welcher Ziele abgedeckt werden kann.
Quantitativ lässt sich dieser Bedarf nicht zuverlässig beziffern, zumal ein umfassender Überblick über editorische Tätigkeiten von Wissenschaftler*innen an der eigenen Einrichtung fehlt und deren systematische Erfassung eine große Herausforderung darstellt.26 Über die Fachreferent*innen der UB wurden zunächst drei Redaktionen27 ermittelt und in Beratungsgesprächen Unterstützungsbedarfe zur weiteren Professionalisierung als OA-Journals identifiziert. Die Ausgangslage lässt sich so zusammenfassen, dass die drei eJournals bislang verschiedene Publikationsplattformen bedienen und unterschiedliche Optimierungsbedarfe haben. Ein grundsätzlicher Bedarf besteht demnach in einer möglichst effizienten und komfortablen Abwicklung der Kommunikationsprozesse, die bisher E-Mail-basiert realisiert wurden. Weitere Lücken betreffen die fehlende Vergabe von CC BY-Lizenzen und DOIs für Publikationen, keine Integration mit ORCID, sowie eine fehlende Sicherstellung der Langzeitarchivierung. Neben der Generierung unterschiedlicher Zielformate, wie PDF, HTML oder weitere, soll auch die Sichtbarkeit sowohl der eJournals als auch der einzelnen Publikationen verbessert werden, u.a. durch Registrierung im DOAJ oder Indexierung in fachlichen und Zitationsdatenbanken.
Da für die Umsetzung und Betreuung des neuen Services keine zusätzlichen personellen Ressourcen zur Verfügung stehen, kam für die UB nur eine kooperative Lösung infrage, mit der sich die verschiedenen Aufgaben und Zuständigkeiten auf mehreren Schultern verteilen lassen. Entsprechend übernimmt das hbz die Rolle des technischen Host für OJS, die UB den 1st-Level-Support und die Herausgebenden die Sicherstellung der redaktionellen Abläufe ihres eJournals.
Des Weiteren wurde die Nutzung von Synergien auf technisch-administrativer Ebene angestrebt, was einerseits in der vom hbz in Absprache mit den Bibliotheken erfolgten OJS-Konfiguration mit einem standardisierten Set an Plug-ins, andererseits über die Nachnutzung von bereits im Repositorium RWTH Publications verwendeter persistenter Identifier (PIDs) - DOI und ORCID - erreicht wurde.
Der Dienst RWTH Open Access Journals wurde innerhalb eines halben Jahres erfolgreich aufgesetzt und ein Vorgehen entsprechend Tab. 1 gewählt.
Umsetzungsphase | Schritte |
|---|---|
Ist-Stand-Erfassung |
|
Konzepterstellung |
|
Klärung von Rollen, Rechten und Pflichten |
|
Vorbereitung Go-live |
|
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit |
Der neue Service startete im September 2024 zunächst mit der nach OJS migrierten Zeitschrift archimaera. Mittelfristig wird das Ziel angestrebt, das „Onboarding“ weiterer interessierter eJournals zu betreuen. Längerfristig soll das Angebot auch um die Betreuung von Schriftenreihen erweitert werden.
Darüber hinaus werden die mit RWTH Open Access Journals gewonnen Erfahrungen bei der Einführung bzw. Erweiterung des Dienstes für die Publikation von Open Access Büchern hilfreich sein.
Die Architekturzeitschrift archimaera ist das erste Beispiel für die Migration eines Journals auf die neue Publikationsplattform RWTH Open Access Journals. Als Diamond Open Access Journal wurde archimaera im Jahr 2007 von wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen der Architekturfakultät der RWTH gegründet und zielt seitdem mit jährlichen bis zweijährlichen Ausgaben auf einen interdisziplinären Diskurs zu relevanten Themen der Architekturpraxis, -theorie und -geschichte ab. Durch die frühzeitige Gründung kurz nach der Berliner Erklärung hat sich archimaera als eine der wenigen frei zugänglichen und wissenschaftlichen Architekturzeitschriften im deutschsprachigen Raum etabliert.32 In regelmäßigen Abständen bittet die Redaktion die heterogene Fachcommunity um historisch-wissenschaftliche, künstlerische und architekturtheoretische Perspektiven auf jeweils ausgerufene Begriffe oder Konzepte.33 Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren inklusive Double Blind Peer Review können beispielsweise Texte zum gleichen Leitthema von einer renommierten Professorin für Architekturgeschichte und eines aufstrebenden jungen Künstlers zum gleichen Leitthema nebeneinander stehen.
Das Herz von archimaera bildet seit 2007 die Website des Journals, welche über eine eigene Domain erreicht wird.34 Zunächst als Journal auf der DiPP-Plattform vom hbz gehostet, wurden die Inhalte der Website mit Hilfe einer Plone-Instanz organisiert und veröffentlicht. Mit der Zeit stellte sich heraus, dass die Leser*innen von archimaera die Artikel der Ausgaben trotz einer nativen HTML-Darstellung im PDF-Format bevorzugten. Während die HTML-Version der Artikel deshalb aufgegeben wurde, stellte ein umfangreiches Redesign der Website im Jahr 2019 den Charakter der archimaera-Ausgaben als kohärente Anthologien in den Mittelpunkt und hebt seitdem durch ein minimalistisches Webdesign die Präsenz der Titelblätter der Ausgaben und Artikel hervor (Abb. 1).
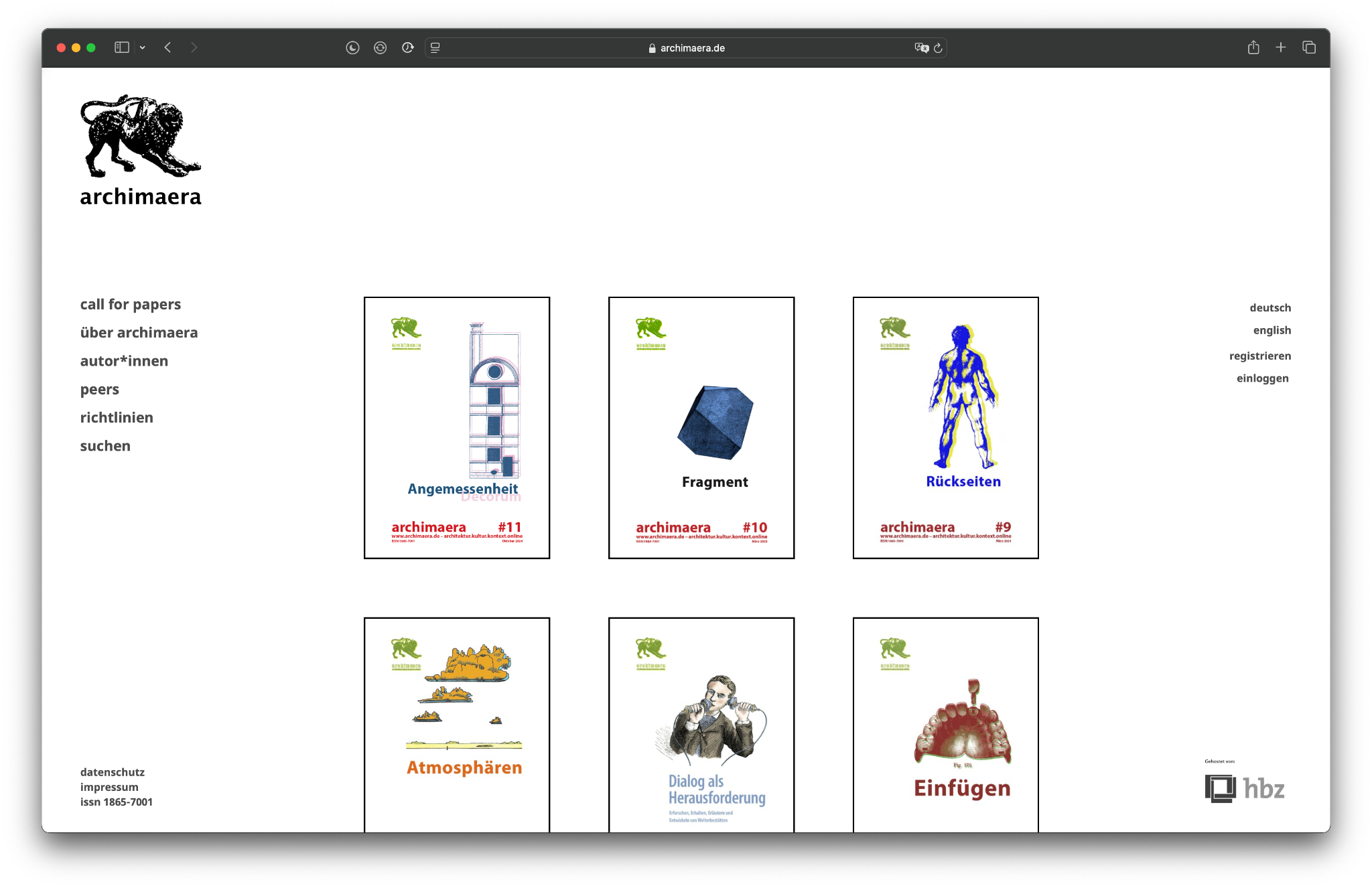
Mit dem Aufbau von RWTH Open Access Journals deutete sich ab März 2023 die Möglichkeit für archimaera an, zum einschlägigen Open Journal System zu wechseln. Während die individuelle Gestaltung des archimaera-Themes für Plone eine gewisse Herausforderung für die Redaktion darstellte und nicht nur Kenntnisse im Web-Development voraussetzte, sondern auch die tatkräftige Unterstützung durch Entwickler*innen des hbz, gelang die Übertragung des individuellen Designs von archimaera in OJS weitestgehend durch das einfache Überschreiben eines Standard-Themes mit einem Custom Cascading Style Sheet. Strukturelle Änderungen am Aufbau und Layout der einzelnen Seiten konnten über Umwege durch das Hinzufügen einiger weniger JQuery-Skripte in den Header der Seiten erzielt werden. Der Umzug von archimaera zur neuen Publikationsplattform RWTH Open Access Journals verlief trotz zahlreicher Eigenheiten der Zeitschrift und der individuellen Wünsche der Redaktion weitestgehend reibungslos. Allerdings konnte hierbei kaum auf existierende Import-Plug-ins und OJS-Themes zurückgegriffen werden, sodass für die Migration die Erstellung eines Skripts durch einen Entwickler des hbz und für das Anpassen des Webdesigns fortgeschrittene Kenntnisse in den Kernsprachen des World Wide Webs innerhalb der Redaktion notwendig waren.
Angekommen auf der neuen Publikationsplattform und in OJS, bieten sich archimaera nun neue Möglichkeiten, die redaktionelle Arbeit und die Präsentation der Inhalte weiter zu professionalisieren. Mit der jüngsten und elften Ausgabe vergibt archimaera nun DOIs für jeden einzelnen Artikel, während die Basis-Tools und die Plug-in-Architektur von OJS der Redaktion viele Erleichterungen, wie zum Beispiel den Publikationsworkflow oder das niederschwellige Management der Inhalte in mehreren Sprachen ermöglicht. Trotz der skript-basierten Migration und den technischen Möglichkeiten von OJS, wäre der Umzug von archimaera nicht ohne die hohe Motivation der beteiligten Mitarbeitenden des hbz, der UB und der Redaktion möglich gewesen. Wie es bei Diamond Open Access Journals häufig der Fall ist,35 wird die Arbeit der Redaktion ausschließlich durch den akademischen Idealismus ihrer Mitglieder angetrieben. Somit ist es umso wichtiger, dass die redaktionelle Arbeit durch nicht entgeltpflichtige Service-, Migrations-, Einrichtungs- und Hosting-Angebote unterstützt wird, wie zum Beispiel durch ein von Peter Reimer (hbz) eigens geschriebenes Skript für die Migration der vergangenen Ausgaben.36
Die Gründung und Herausgabe eines Diamond-OA-Journals ist nicht trivial.37 Neben Aspekten wie Marktanalyse, Zuschnitt des thematischen Spektrums, Zusammensetzung eines Editorial Boards, Organisation des Peer-Reviews und vor allem die nachhaltige Finanzierung, stellen nicht zuletzt Auswahl, Betrieb, Pflege und Finanzierung einer geeigneten Publikationsplattform eine große Herausforderung dar.38
Die UB der RWTH Aachen ist daher erfreut, dass sie mit dem hbz im Rahmen der Landesinitiative openaccess.nrw einen starken Partner gefunden hat, um eine standardisierte und etablierte Publikationsinfrastruktur in Form von OJS verbunden mit einem umfangreichen Serviceportfolio anbieten zu können.
In technischer Hinsicht ist für RWTH Open Access Journals absehbar, dass weitere Migrationen bestehender Plattformen nach OJS zu meistern sein werden. Ihre Herausforderungen liegen im Spannungsfeld zwischen der technischen Machbarkeit der Individualität eines eJournals einerseits und den Möglichkeiten einer standardisierten Multijournal-Publikationsplattform andererseits.
Über all dem schwebt die Frage, wie die Herausgabe und redaktionelle Arbeit von eJournals im Diamond-OA-Modell langfristig und nachhaltig gefördert werden kann. Denkbar wäre, einen Teil des Publikationsfonds dieser Form des wissenschaftsgeleiteten Publizierens zu widmen.