Dienst- bzw. Behördenbibliotheken, die zunächst vorrangig für die Nutzung durch die Belegschaft eines Amts eingerichtet worden sind, standen lange Zeit nicht im eigenen und ebenso nicht im fremden Fokus der Provenienzforschung und der damit vorhandenen Fragen der Selbstverpflichtung nach Recherche und ggf. Rückgabe von Medien an die rechtmäßigen Eigentümer gemäß der Washingtoner Erklärung.1 Dabei haben die Dienstbibliotheken, die bereits seit mehreren Jahrzehnten bestehen, ihre Bestände wie große wissenschaftliche Bibliotheken oft durch Ankäufe aus dem Antiquariatsmarkt oder Sammlungsübernahmen vermehrt und unterliegen somit denselben grundsätzlichen Notwendigkeiten der Provenienzrecherche.2
2023 stieß der Autor dieses Beitrags bei bewusster Durchsicht der Sammlungen der Bibliothek des Landesamts für Denkmalpflege auf einige Provenienzen, die Indizien für jüdisches Eigentum beinhalten. In Abstimmung mit dem Deutschen Zentrum Kulturgutverluste entwickelte das Landesamt für Denkmalpflege Sachsen (LfDSN) einen Projektantrag zur Durchführung einer systematischen und umfassenden Provenienzrecherche.3 Da das LfDSN das erste seiner Art in Deutschland ist, das sich intensiver mit der Provenienzrecherche befasst, sollen einleitend einige Hinweise zu den Rahmenbedingungen und zum Vorgehen gegeben werden, da auch für andere Landesämter die Provenienzrecherche in Frage kommen wird. Eine Arbeitsgruppe der Vereinigung der Denkmalfachämter der Länder (VDL), wie sie für andere Bereiche der Denkmalpflege in der VDL existieren, gibt es bislang für Sammlungsaspekte noch nicht, so dass die Landesämter in dieser Thematik auf anderen Wegen zusammenarbeiten müssen. Das Niedersächsische Landesamt ist Teil des niedersächsischen Netzwerks Provenienzforschung, allerdings vor allem aufgrund seiner Aufgabe als Genehmigungsbehörde für die Ausfuhr von Kulturgut.4
Das LfDSN verfügt seit der Gründung der Königlichen Kommission zur Erhaltung der Kunstdenkmäler 1894 als Vorgängereinrichtung über eine ungebrochene Sammlungskontinuität, die zweifach bemerkenswert ist.5 Durch die Auslagerung der Sammlungsbestände ins Schloss Weesenstein im Zweiten Weltkrieg gelang es zum ersten, sie vor Kriegsverlusten zu bewahren und ebenso vor Dezimierungen im Jahr des Kriegsendes, als nicht selten verlagertes Kulturgut geplündert wurde. Das eigentliche Dienstgebäude des Amts, das Palais Wackerbarth, wurde 1945 teilzerstört und 1962/63 abgerissen. Mit dem Rücktransport der Sammlungen nach Dresden noch im Jahre 1945 in den nunmehrigen Dienstsitz des Amts, dem Ständehaus am Schloßplatz, standen diese dem Personal zur Benutzung sofort wieder zur Verfügung. Zum zweiten wurden die Sammlungen bewahrt, in dem sie trotz der Neugliederung und Zentralisierung der Denkmalpflege in der DDR zusammenhängend im Ständehaus verblieben. 1952 erfolgte die Gebietsgliederung in Bezirke – die Länder wurden nominell nie aufgelöst, so dass beispielsweise die Länderkammer der DDR bis 1958 weiterbestand. In Ost-Berlin wurde das Institut für Denkmalpflege gegründet und die bis dahin bestehenden Landesämter für Denkmalpflege als Arbeitsstellen weitergeführt. Mit der Wiederbegründung des LfDSN 1993 erstreckt sich dessen Zuständigkeit auf das Gebiet des Freistaats Sachsen.
Aufgrund dieser bewahrten Kontinuität ergeben sich für die Provenienzrecherchen in den Sammlungen des LfDSN bestimmte Rahmenbedingungen, die für die Provenienzforschung zu beachten waren und sind. Erfahrungen anderer Landesämter für Denkmalpflege konnten aus dem einleitend genannten Grund nicht herangezogen werden. Allgemeine Hinweise zu Provenienzrecherchen gab die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB), die bereits zahlreiche Provenienzprojekte durchgeführt hat.6 Seit 2024 ist das LfDSN Teil der sächsischen Arbeitsgemeinschaft für Provenienzforschung.
Wie geschildert, liegt im Bestand der Sammlungen seit nun mehr als 130 Jahren eine große Kontinuität vor.7 Aufgrund des Aufbaus und Inhalts der Sammlungen war bereits vor der Provenienzrecherche deutlich geworden, dass einige Bestände ausschließlich Amtsüberlieferungen, also amtliches Material, beinhalten, in denen keine Provenienzen Dritter zu erwarten waren. Diese Sammlungen schieden deshalb bei der Betrachtung der Provenienzen aus.
Es handelt sich bei den Sammlungen des LfDSN um folgende:
Topografische Registratur
Die ältesten Akten wurden 1894 mit Gründung der Kommission zur Erhaltung der Kunstdenkmäler angelegt und nach Gründung des Landesamts 1917 ohne Trennung fortgeführt. Die Archivalien umfassen amtliches Schrift- und teils Bildgut zu sächsischen Kulturdenkmalen. Die Akten der Jahre 1894 bis 1952 (Gründung der Arbeitsstelle des Instituts für Denkmalpflege) bilden den Altbestand. Aus den Jahren 1952 bis 1993 (Wiedergründung des LfDSN) besteht die mittlere Gruppe, der sich die jüngeren Akten ab 1993 anschließen. Die Akten 1894 bis 1952 sollen im Rahmen eines Retrodigitalisierungsprojekts in den nächsten Jahren digital zugänglich gemacht werden.
Bauteilsammlung
Bereits in der Frühzeit der Anlage der Sammlungen wurden einzelne bauliche Objekte gesammelt, um an ihnen kunstwissenschaftliche oder restauratorische Forschungen zu betreiben. Dieses Sammlungsgut wurde später abgegeben. Im Jahr 2023 wurde die Bauteilsammlung aufgrund der großen Zahl der aus dem Bergelager für historische Baustoffe Trebsen und weiterer Zugänge, zum Beispiel aus Nachlässen von Künstlern und Restauratoren, neu begründet. Nach jetziger Kenntnis befindet sich in dieser Sammlung nichts, was Anlass für eine Provenienzforschung im Sinne der Washingtoner Erklärung geben würde.
Dokumentationen und Diapositive
Diese in den 1960er Jahren entstandene Sammlung beinhaltet vor allem denkmalpflegerische Zielstellungen und Berichte von Restauratoren, die bestimmte Arbeiten schriftlich und bildlich dokumentiert haben. Zur Sammlung gehört auch ein größerer Fundus an Farbdiapositiven, der jedoch wie die Dokumentationssammlung selbst aufgrund der Sammlungsgeschichte keine Indizien besitzt, der diesen Bestand für eine Provenienzrecherche empfehlen würde.
Fotosammlung und Negativarchiv
Durch die Amtsfotografen wurden und werden bis heute Fotografien von Baudenkmalen usw. erstellt, die in den Bestand der LfDSN eingehen. Der Grundbestand dieser Sammlung stammt noch aus dem Inventarisationswerk von Richard Steche und Cornelius Gurlitt aus den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Da im Laufe der letzten Jahrzehnte zahlreiche gut dokumentierte Teilsammlungen in den Bestand integriert worden sind, dürften im Sinne der Provenienzforschung relevante Eigentumsverhältnisse nicht vorhanden sein. Perspektivisch soll jedoch die Fotosammlung dennoch auf Provenienzen geprüft werden.
Plansammlung
Der 70.000 Blatt umfassende Bestand mit Zeichnungen, Aufmaßen, Grafiken, Grundrissen und Karten stammt aus zahlreichen Quellen, u.a. der von Gurlitt angelegten Sammlung für Baukunst an der Technischen Hochschule Dresden (heutige Technische Universität Dresden), die 1908 mit Fotografien und Negativen zum Königlichen Sächsischen Denkmalarchiv zusammengefasst wurde. Diese Sammlung gelangte 1912 ins Palais Wackerbarth, wo sie bis zur kriegsbedingten Auslagerung verblieb. Die Plansammlung muss aufgrund der Vielzahl der vorhandenen Provenienzen systematisch geprüft werden.
Bibliothek
Ebenfalls eine der am frühesten angelegten Sammlungen war die Bibliothek, die sich noch auf die Erhaltungskommission zurückführen lässt. Die ältesten Bestände reichen bis in das 15. Jahrhundert zurück und umfassen neben den einschlägigen Werken zur Kunstgeschichte, Architektur und Denkmalpflege fast alle Wissensgebiete. Die Bibliothek umfasst heute ca. 75.000 Medieneinheiten. Unter den zahlreichen übernommenen Sammlungen befinden sich Bestände aus den „Schlossbergungen“ der Jahre 1945 ff, von anderen öffentlichen Einrichtungen wie Museen abgegebene Konvolute aus dem eigenen und sowie Fremdbeständen, den seit den 1950er Jahren systematisch durchgeführten Käufen aus Antiquariaten u.a.m. In der übernommenen Bibliothek des Instituts für Kulturwissenschaft der Technischen Hochschule Dresden befand sich wie in der Bibliothek des Landesamts Bodenreformgut.
Die Sammlungen werden heute durch die Belegschaft des Amts und durch die Öffentlichkeit genutzt (nach Anmeldung). Mit Ausstellungen, Publikationen, Vorträgen und die Einbindung in das Curriculum einzelner Lehrfächer der Technischen Universität Dresden gibt es eine größere Sichtbarkeit der Sammlungen in der Öffentlichkeit. Die räumlichen Gegebenheiten lassen eine Entwicklung der Sammlungen zu einem „Dritten Ort“ nicht zu, aber dennoch verfolgt das Amt das Bestreben, die Sammlungen noch bekannter zu machen.

Bei der Katalogisierung der Bestände des LfDSN und bei der Migration auf den elektronischen Katalog im Jahr 2022 wurden Provenienzen nicht berücksichtigt, so dass bis auf die im dritten und vierten Quartal 2023 durchgeführten Stichproben keine Erkenntnisse vorliegen.
Im Zuge der Restitutionsanträge auf Rückgabe von Bodenreformgut wurde die Bibliothek nach den jeweils angefragten Provenienzen durchgesehen, ohne dies jedoch unabhängig von den Anträgen für den gesamten Bestand durchzuführen, was vor allem personelle Gründe hatte (One Person Library). Im Rahmen dieser Recherchen wurde eine erste Übersicht mit den meistvorhandenen Provenienzen angefertigt, die jedoch keine dazugehörigen Titel aufführt, sondern nur Provenienzmerkmale (Exlibris, Supralibros, Stempel u.a.) und die Bezeichnung des Sammlers bzw. der Bibliothek auflistet, für die die Provenienzmerkmale stehen. Für eine tiefgehende, systematische Provenienzrecherche kann diese Aufstellung nur informativen Charakter haben, da sie Einzelherkünfte nicht beinhaltet.
Genutzt werden sollen die erhalten gebliebenen Zugangsbücher der Sammlung sowie Archivalien im Archiv der LfDSN und des Sächsischen Staatsarchivs. Die Überlieferung der Zugangsbücher beginnt 1947. Davor befindet sich weder im LfDSN noch im Staatsarchiv eine primäre bzw. Parallelüberlieferung an Zugangsbüchern oder anderem vergleichbaren Material.
In den Unterlagen der Bibliothek befindet sich Schriftwechsel zur Übernahme von Sammlungen und zum Austausch von Medien mit anderen Einrichtungen. Dieser Schriftwechsel wurde für die Restitutionsanträge ausgewertet. Da er jedoch sehr summarisch ist und kaum Einzelnachweise – besonders bei übernommenen Sammlungen – enthält, kann mit ihm auf Exemplarebene ebenfalls nicht gearbeitet werden.
Summarisch kann konstatiert werden, dass für eine Provenienzrecherche des Bestands kaum Vorarbeiten vorliegen.
Bei einer ersten Durchsicht des Bibliotheksbestandes im Jahr 2023 wurden in kurzen Stichproben drei Verdachtsfälle ermittelt, die, wie beschrieben, den Anlass für den Projektantrag gaben. Es wurden zwei Bücher mit den handschriftlichen Einträgen „M. Frühling. Jan. 1899“ sowie „M. Frühling Berlin 1899“ gefunden. Die anscheinend weibliche Handschrift verweist auf eine Person in Berlin um 1900. Im Adressbuch von Berlin sind mehrere Familien mit dem Namen „Frühling“ verzeichnet, darunter Salomon und Simon Frühling. In der Datenbank ist „L. Frühling Berlin-W.“ verzeichnet (Objektnummer 238539)8. Aufgefunden wurde ein Buch mit dem Eintrag: „Max Singer“ (um 1900), ohne Ortsangabe. Der Namenszug Max Singer kann auf mehrere Personen verweisen. In Berlin existiert für eine Person mit dem Namen Max Singer ein Stolperstein, geboren 1882, ermordet 1943 in Auschwitz. In der systematischen Recherche ist zu eruieren, ob eventuell weitere aufzufindende Bände eine geographische Eingrenzung ermöglichen (wie bei dem Beispiel „M. Frühling“, bei dem nur in einem Exemplar der Ort vermerkt wurde, bei dem anderen nicht). Außer den Namenszügen sind in den drei genannten Büchern keine weiteren Provenienzmerkmale vorhanden.
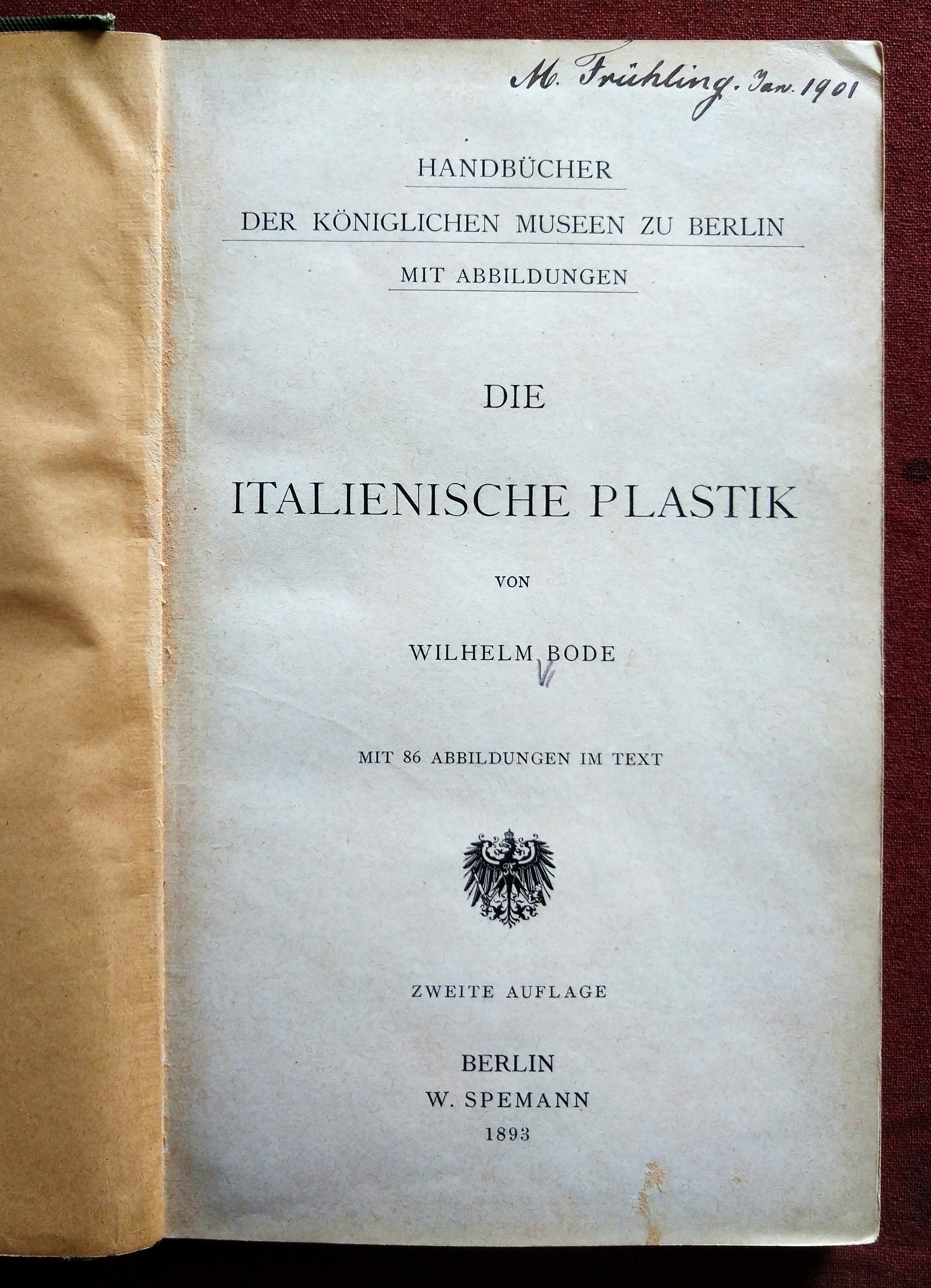
Im Bibliotheksbestand existieren Bücher mit Stempeln z.B. osteuropäischer Privat- und öffentlicher Bibliotheken, bei denen Raubgutverdacht besteht. Die Bücher kamen nach 1945 durch zweite Hand in das LfDSN. Bücher aus dem Besitz von in der NS-Zeit politisch verfolgten Personen oder von verbotenen Organisationen (wie Freimaurerlogen oder Parteien) sind bisher bei den Stichproben nicht entdeckt geworden. Verdachtsfälle in der Plansammlung konnten bisher nicht festgestellt werden.
Anhand dieser Lage erfolgte ein Antrag an das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste. Der Antrag sieht vereinfacht dargestellt folgende Schritte vor:
Verdächtige Teilbestände werden durch Durchsicht und Feststellung relevanter Provenienzen per Autopsie unter Zuhilfenahme von Materialien wie Zugangsbüchern u.a. identifiziert.
Die aufgefundenen Provenienzen werden ermittelt. Mit Hilfe von Zugangsbüchern und anderem Material sollen in Vorbereitung der Restitution die Provenienzverläufe/Eigentümer möglichst lückenlos ermittelt werden. Das umfasst die Herkunft, die Überprüfung der Hintergründe, die Verlustumstände und die sichere Identifizierung des Vorbesitzers. Diese Angaben werden in einer Datenbank erfasst, klassifiziert und bewertet. Die Provenienzmerkmale werden fotografisch erfasst. Differenziert wird nach Personen und Körperschaften, da sich die Provenienzverläufe aus privatem und institutionellem Besitz erheblich unterscheiden und deshalb unterschiedliche Rechercheverfahren notwendig machen.
Die Dokumentation der Ergebnisse dient der Transparenz und Nachnutzbarkeit (Meldung von NS-Raubgut an die Datenbank Lost Art bzw. Looted cultural assets, Nutzung von Normdatensätzen der Gemeinsamen Normdatei (GND) für die zu veröffentlichenden Angaben mit Abbildungen der gefundenen Provenienzen sowie Veröffentlichung der Datenbank auf den Webseiten des LfDSN). Eine Anzeige im Bibliothekskatalog des LfDSN ist auf absehbare Zeit noch nicht möglich.
Neben den hier genannten „hard skills“ sind auch die „soft skills“ zu berücksichtigen. Ohne die Belegschaft ist kein Provenienzforschungsantrag durchzuführen, der ggf. in die Abgabe von Teilbeständen mündet. Die Sensibilisierung, so noch nicht geschehen, muss mit enger Einbindung der Belegschaft erfolgen. Die Sensibilisierung besteht vor allem aus zwei Komponenten: a) Das Bewusstmachen der historischen Prozesse, die zur Bestandsübernahme fremder Provenienzen führten, die heute in die Überprüfung des Bestandes und damit im Fall der Fälle auch in der Abgabe von Beständen an die Eigentümer*innen münden können und b) In der Aufmerksamkeit bei der täglichen Arbeit mit dem Bestand, Provenienzen kontinuierlich zu vermerken. Die Belegschaft des LfDSN steht diesen Aufgaben offen gegenüber, zumal Rückgaben, vor allem historischen Mobiliars, vor allem aus der Bodenreform an die Eigentümer*innen in den vergangenen 30 Jahren immer wieder stattgefunden haben. Die Recherche und ggf. Abgabe bezieht sich nun auf die eigentlichen Sammlungen. Das LfDSN sieht sich in der Verpflichtung, die Washingtoner Erklärung umzusetzen und Provenienzen in den Sammlungsbeständen selbständig und anlasslos zu prüfen.
Das LfDSN hat beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste im September 2024 den Antrag auf Recherche gestellt, über den im Frühjahr 2025 entschieden werden soll. In der Planung für den Doppelhaushalt 2025/26 des Freistaats hat das LfDSN 2024 in Erwartung der Bewilligung des Antrags durch das Zentrum entsprechend notwendige Mittel zur Erfüllung der Eigenleistungen beantragt. Derzeit wird an der Haushaltsaufstellung für den Freistaat Sachsen gearbeitet, die in den nächsten Wochen abgeschlossen sein soll. Beschäftigt werden sollen ein wissenschaftlicher Mitarbeiter*in sowie eine Hilfskraft auf Werkvertragsbasis. Mit der Bewilligung, die hoffentlich erfolgen wird, wird in einem zweijährigen Projekt der relevante größere Teilbestand von ca. 40.000 Bänden nach Provenienzen jüdischen Eigentums untersucht, Provenienzverläufe ermittelt, Provenienzmerkmale veröffentlicht und die Öffentlichkeit informiert. Perspektivisch werden aufgefundene und klar zugeordnete Bestände aus jüdischem Eigentum, wo möglich, zurückgegeben. 2027 soll die Durchsicht der Bibliothek beendet sein. Versetzt parallel oder im Anschluss wird die Recherche in der Plansammlung erfolgen.
Mit den Überlegungen von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden, eine neue Schiedsgerichtsbarkeit zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts aufzubauen, wird die Provenienzforschung weiteren Auftrieb erhalten.9 Provenienzrecherche in den Landesämtern für Denkmalpflege ist also keine terra incognita mehr. Es wird interessant werden, welche Verbindungen und Parallelen bei der Aneignung jüdischen Eigentums zu anderen Einrichtungen bestanden, das – nach jetzigen Kenntnissen – nicht aus erster Hand, sondern aus zweiter oder dritter Hand in die Bibliothek gelangte. Das beantragte Projekt kann beispielgebend für andere vergleichbare Einrichtungen werden – auch hier werden beim Eingang jüdischen Eigentums in die Sammlungen länderübergreifende Parallelen und Abweichungen die Provenienzforschung bereichern.